Der Rettungsdienst des BRK Coburg

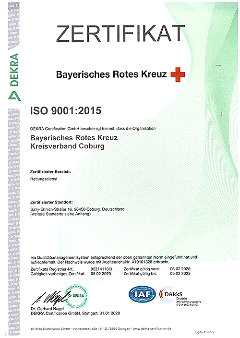
Aktuelles aus dem Rettungsdienst
Überraschung: Der 23-jährige Verkäufer Lukas Friedrich überraschte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BRK-Rettungswache mit einem herzlichen (und leckeren) Dankeschön. Darüber freuten sich (von links): Stellvertretende Wachleiterin Celine Meier, Leiter Rettungsdienst Volker Drexler-Löffler, Notfallsanitäter Thomas Vollrath, Lukas Friedrich, Auszubildende Notfallsanitäterin Rebecca Rohé und stellvertretende Leiterin Rettungsdienst Jasmin Dürr

Der Rettungsdienst des BRK Kreisverbands Coburg ist mit seinen drei Rettungswachen und dem Stellplatz in Seßlach ein wichtiges Standbein für die präklinische Notfallversorgung in der Stadt und im Landkreis Coburg - Insgesamt sind im BRK Kreisverband tagtäglich 4 Rettungswagen, 3 Krankenwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug in Betrieb.
Durch ein ausführliches Qualitätssicherungssystem wird die Leistungsfähigkeit regelmäßig überprüft und zertifiziert.
BRK Notfallrettung in lebensbedrohlichen Situationen
Die Notfallrettung des BRK Rettungsdienstes zählt zu den wichtigsten Aufgaben. Die Leitstelle alarmiert nach Notrufeingang einen Rettungswagen (kurz RTW), der regulär mit einem Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter besetzt ist und disponiert diesen zu Patienten in lebensbedrohlichen Situationen. Je nach Einschätzung der Leitstelle kommt zusätzlich ein Notarzt zum Einsatz.
Weitere typische Aufgaben des Rettungsdienstes sind Verlegungen von Patienten in spezialisierte Kliniken, zum Landeplatz des Rettungshubschraubers oder das Abholen von Neugeborenen aus umliegenden Krankenhäusern in die Kinderintensivstation des Klinikums Coburg mittels eines sogenannten Transportinkubators.
Wann kommt der BRK Krankentransport zum Einsatz?
Der Krankentransport bzw. der Krankentransportwagen (kurz KTW) kommt zum Einsatz, wenn Menschen, die erkrankt oder verletzt sind, sich aber nicht in einem schwer- oder lebensbedrohlich erkranktem Zustand befinden, eine besondere medizinische Betreuung und Logistik benötigen. Beispiele hierfür sind: ein Krankentransport von zu Hause in eine Klinik oder auch von Klinik zu Klinik.
Ein Team aus einem Rettungssanitäter und einem Fahrer mit einer Sanitäts- oder Rettungsdiensthelferausbildung übernehmen den perfekt auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmten, schonenden Transport und die medizinisch notwendige Überwachung.
BRK Ausbildung und Freiwilliges soziales Jahr
Eine Ausbildung oder ein freiwilliges soziales Jahr beim BRK Rettungsdienst Coburg bietet jungen Menschen die besondere Möglichkeit, soziales Engagement mit wertvollen Erfahrungen zu verbinden.
Nach einer Ausbildung zum Rettungsdiensthelfer arbeiten die Freiwilligen für ein Jahr im Krankentransport und lernen im Umgang mit Patienten und Kollegen im wahrsten Sinne des Wortes für das Leben. Dabei können die jungen Menschen bis zum Ende der Dienstzeit auch begleitend die Qualifikation des Rettungssanitäters erwerben.
In jeder der BRK Rettungswachen in Coburg begleiten qualifizierte Praxisanleiter Auszubildende, die sich der 3-jährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter unterziehen oder aber die Ausbildung zum Rettungssanitäter absolvieren. Ein großer Wert wird auch auf die ständige Fort- und Weiterbildung des hauptamtlichen und ehrenamtlichen Personals gelegt.
Was ist der Erweiterter Rettungsdienst?
Der BRK Kreisverband Coburg ist in der Lage einen sogenannten „Erweiterten Rettungsdienst“ zu stellen, zum Beispiel bei Großschadenslagen, einem Einsatz mit zahlreichen Verletzten oder bei erhöhtem Einsatzaufkommen, wie bei Blitzeis.
Dieser wird aus den ehrenamtlichen Einsatzformationen des Roten Kreuzes – den Bereitschaften und den Wasserwachten – gestellt.
Im Landkreis Coburg stehen 5 Rettungswagen und 4 Krankenwagen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bereit, die im Bedarfsfall von der Integrierten Leitstelle (ILS) alarmiert werden. Diese gleichen in der Ausstattung annähernd den öffentlich-rechtlichen Einsatzfahrzeugen. Auch der Ausbildungsstand der ehrenamtlichen Besatzungen entspricht größtenteils dem des hauptamtlichen Personals.
Helfer vor Ort (HVO) werden ebenfalls zum „Erweiterten Rettungsdienst“ gezählt – die auch durch die ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Gemeinschaften gestellt werden. Sie werden im Bedarfsfall in den betreffenden Gemeinden alarmiert, um schnellstmöglich medizinische Hilfe zu leisten und um die Zeit bis zum Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes zu überbrücken.
Folgende Fahrzeuge stehen für den Erweiterten Rettungsdienst zur Verfügung:
Coburg
- RTW der BRK-Bereitschaft Coburg
- KTW Typ B der BRK-Bereitschaft Coburg
Ebersdorf
- KTW Typ B der BRK-Bereitschaft Ebersdorf
- RTW der BRK-Bereitschaft Ebersdorf
- HVO der BRK-Bereitschaft Ebersdorf
Itzgrund
- 4-Tragen KTW der BRK-Bereitschaft Itzgrund
Neustadt
- RTW der BRK-Bereitschaft Neustadt
- KTW der BRK-Bereitschaft Neustadt
- HVO der BRK-Bereitschaft Neustadt
Rödental
- RTW der BRK-Bereitschaft Rödental-Einberg
Sonnefeld
- KTW Typ B der BRK-Bereitschaft Sonnefeld
Weidhausen
- KTW der BRK-Bereitschaft Weidhausen
- HVO der BRK-Bereitschaft Weidhausen
Fahrzeuge und Technik
Ein Rettungswagen kommt schwerpunktmäßig bei Notfall- und Notarzteinsätzen, aber auch im Rahmen von zeitkritischen Krankentransporten zum Einsatz. Die Regelbesatzung besteht aus zwei Personen, darunter mindestens eine Rettungsassistentin oder ein Rettungsassistent. Die Fahrerin oder der Fahrer des RTW verfügt üblicherweise über eine Rettungssanitäter-Ausbildung.
Seit 2003 gibt es in Bayern beim BRK landesweit einheitliche Fahrzeuge. Das aktuelle Modell ist ein Fahrzeug der Fünf-Tonnen-Klasse mit Aluminiumsandwich-Kofferaufbau, welches bei Bedarf entsprechend der lokalen Erfordernis mit Allradantrieb ausgestattet sein kann. Alle Rettungswagen im bayerischen Rettungsdienst entsprechen mindestens den Anforderungen nach DIN EN 1789, Typ C (Rettungswagen / Mobile Intensive Care Unit) in der bei Beschaffung gültigen Ausführung. Ergänzend zur vorgegebenen Ausrüstung zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen führen die RTW des BRK oftmals zusätzliche Medizintechnik nach örtlichem Bedarf mit.FAQ
Situation: Herrn K. geht es schon seit Tagen nicht gut. Er hat Fieber, Kopf und Gliederschmerzen und fühlt sich gar nicht wohl, gegessen und getrunken hat er auch nicht viel, da er noch zusätzlich unter Übelkeit mit Erbrechen leidet. Den Ratschlag seiner Frau, zum Hausarzt zu gehen, lehnte er mit den Worten „Es ist ja nicht so schlimm, das wird schon wieder“ ab. Nun beschloss Frau K., dass doch etwas unternommen werden muss, so kann es ja nicht weitergehen. Es ist Dienstagabend 19 Uhr und sie fragt sich, an wen sie sich wenden soll: an die Rettungsleitstelle unter der Rufnummer 112 oder an den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117?
Volker Drexler-Löffler, Leiter Rettungsdienst:
„Vor solchen Entscheidungen standen wohl schon viele Erkrankte oder deren Angehörige. Das liegt daran, dass seit 2003 die Anrufer selbst entscheiden müssen, an welche Stelle sie sich wenden: den Rettungsdienst oder den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Zuvor wurden Rettungsdienst und Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst von der Leitstelle gemeinsam verwaltet. Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst stieg jedoch aus diesem Model aus.
In solchen Fällen wie dem oben beschriebenen – wo es sich offensichtlich um einen grippalen Infekt handelt – ist der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 die richtige Anlaufstelle. Dieser stellt die Verbindung zum nächstgelegenen diensthabenden Arzt her und kann einen Hausbesuch organisieren.
Bei schweren oder lebensbedrohlichen Erkrankungen (zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftung) und Verletzungen (zum Beispiel Verkehrsunfälle, Sturz von der Leiter) ist die Telefonnummer der Rettungsleitstelle, die 112, zu wählen. Diese schickt dann umgehend die nötige Hilfe an die Einsatzstelle.“
Ansprechpartner
Volker Drexler-Löffler
Leiter Rettungsdienst
Tel.: 0 95 61/80 89 93
Fax: 0 95 61/80 89 94
mobil: 0171 20 25 623
Jasmin Dürr
stellv. Rettungsdienstleiterin
Wachleiterin Coburg Nord
Tel.: 0 95 61/80 89 95
Fax: 0 95 61/80 89 94
mobil: 0170 47 20 307
Wolfram Krause
Wachleiter Coburg Süd
Tel.: 0 95 61/23 13 305
Fax: 0 95 61/23 13 383
mobil: 0173 38 02 258
Philipp Köster
Wachleiter Bad Rodach
Tel.: 0 95 64/80 05 45
Fax: 0 95 64/80 40 43
mobil: 0151 46 46 53 07






